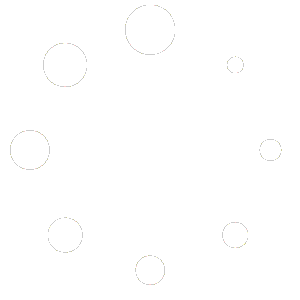Der Begriff Toleranz bezog sich ursprünglich auf die Religion und das geistige Leben und bezeichnete die Duldung von verschiedenen religiösen oder moralischen Vorstellungen. (Meyers Konversationslexikon. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885–1892; oder auch: Brockhaus’ Konversationslexikon. F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894–1896)
Jedes Lebewesen kann nur unter bestimmten äußeren Bedingungen überleben. Der Mensch ist zum Überleben auf eine Körpertemperatur von etwa 37 Grad Celsius und ein bestimmtes Milieu angewiesen, zahlreiche Tiere und Pflanzen sind an einen engen Lebensraum gebunden, sie tolerieren keine wesentliche Abweichung. Jedes Lebewesen hat nur eine geringe Toleranz gegenüber der Änderung seiner Lebensbedingungen.
Das allgemeine Fazit lautet: Leben ist nur innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches möglich.
Jedes Lebewesen von der kleinsten Amöbe bis zum intelligentesten Menschen ist auf den Austausch mit der Außenwelt angewiesen. Der „Stoffwechsel“ beruht auf einer Unterscheidung (Diskriminierung) zwischen dem, was schädlich, und dem, was nützlich für einen Organismus ist. Das, was als Nahrung aufgenommen wird, muß anders behandelt werden als das, was giftig ist und was als Stoffwechselendprodukt auf natürliche Weise zur Ausscheidung bestimmt ist. Dabei gibt es einen Bereich von Substanzen, die weder giftig noch nahrhaft sind, deren Aufnahme also weder nützlich noch schädlich ist, die vom Körper „toleriert“ werden können. Insbesondere in der Pharmakologie spricht man von der Toleranz von bestimmten Organen gegenüber Arzneiwirkstoffen und Zellgiften. In bezug auf den Menschen wird der Einfluß biologischer Gegebenheiten auf die soziale Organisation in Familien und Sippen und auf die Kulturäußerungen, Traditionen und Werte untersucht. Dabei zeigt sich, daß auch das menschliche Zusammenleben auf der Unterscheidung (Diskriminierung) von Verhaltensweisen beruht, die mit dem Leben entweder 1. verträglich oder mit dem Leben 2. unvereinbar sind.
Der Bereich des Verträglichen ist weit. Er umfaßt
- A) das Unabdingbare, Notwendige,
- B) das Förderliche, Nützliche,
- C) das Nutzlose, Unschädliche und schließlich
- D) das Schädliche, aber Noch-Verträgliche.
Innerhalb dieser Normenskala können also die nur verträglichen Verhaltensformen toleriert werden, während die unvereinbaren und ein Teil der schädlichen durch normative Festlegungen wie Gesetze ausgeschlossen werden.
Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Stufen ist schwierig und von der Weltanschauung abhängig. Für das Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft oder als Bürger in einem Staate ist es unabdingbar, daß sich die Bürger einerseits gegenseitig „in Ruhe lassen“, sich also in das Leben der anderen nicht einmischen und ihre bürgerliche Freiheit gegenseitig achten, sich aber andererseits doch „einmischen“, wenn es darum geht, daß die gemeinsame Ordnung aufrechterhalten bleibt und Bürgerruhe und bürgerliche Freiheiten nicht verletzt werden. Bürgerruhe und Bürgerpflicht stehen in einem Wechselverhältnis.
Während die Bürgerpflichten durch Gesetze geregelt werden, die das für den Staat Notwendige gebieten und das mit ihm Unvereinbare verbieten, besteht der Bereich der bürgerlichen Freiheit aus Verhaltensweisen, die als sozial gut angesehen werden („die guten Sitten“) und solchen, die als neutral oder schlecht angesehen werden, die aber nicht verboten sind. Zu diesem Toleranzbereich gehören Verhaltensweisen, die etwa der menschlichen Unvollkommenheit (Dummheit, Selbstsucht) oder Triebstruktur geschuldet sind und nicht verboten werden können.
Der Toleranzbereich entsteht aufgrund der Differenz zwischen den zwei Normensystemen des Rechts und der sittlichen Werte, die sich überlagern. Was das Recht rein rechtlich zuläßt, was aber das Wertesystem als falsch, schlecht oder minderwertig ausschließt, ist das Territorium der Toleranz.
In einer Demokratie ist die politische Meinung des Bürgers von Bedeutung, und deshalb ist diese Meinung wie in keinen anderen System umkämpft. Soweit die Bürger an der Willensbildung im Staate teilnehmen und sich offen äußern, können auch politische Auffassungen dem Staate nützlich oder schädlich sein. Während die Gesetze gewisse Meinungen verbieten, wird auf dem Gebiet der freien Meinung zwischen solchen unterschieden, die staatskonform sind und solchen, die als mit der Grundordnung nicht vereinbar beurteilt werden.
Letztere unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) der Beobachtung durch einen Inlandsgeheimdienst und werden offiziell im Rahmen der Meinungsfreiheit als „Extremismus“ toleriert, in Wirklichkeit aber zum Teil mit harten Sanktionen belegt. Ob hier noch von Toleranz gesprochen werden kann und die rechtliche Gleichheit gewährleistet ist oder ob ein rechtlicher Sonderweg beschritten wird, ist umstritten. Vielmehr scheinen sich deutliche Widersprüche bei der Verwendung des Terminus aufzutun, wie es bei den Begrifflichkeiten „Für Toleranz – Gegen Rechts“ oder „Bunt statt Braun“ offenkundig wird. So hat „Gegen Rechts“ mit politischer Toleranz nichts gemein; „Bunt statt Braun“ ist ebenfalls widersprüchlich, weil ein „Bunt“ ohne „Braun“ insbesondere aus dem Blickwinkel der Malerei und Kunst kein richtiges „Bunt“ sein kann.
In bezug auf nationalgesinnte Deutsche ist die BRD ein repressives, politisch Andersdenkende ausgrenzendes, unterdrückendes und verfolgendes Regime. In zunehmendem Maße werden im bundesdeutschen Besatzungskonstrukt Angehörige des deutschen Volkes herabgewürdigt, geschädigt und ihrer völkischen Identität beraubt.
„Toleranz – Die 9. Todsünde der zivilisierten Menschheit“
Es gibt kaum ein besseres Beispiel für dieses Erlahmen der Abwehrbereitschaft als die Umdeutung des Wortes „Toleranz“. Die heutige Form der Toleranz ist die 9. Todsünde der zivilisierten Menschheit. Ob sie in der Notwendigkeit ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung liegt, vermag nur ein Ethologe zu sagen. Festzustehen scheint, daß ihr trotz vielstimmiger Warnrufe und glasklarer Fakten nicht beizukommen ist. Vielleicht ist diese weiche, pathologische Form der Toleranz tatsächlich ein wichtiger Indikator für einen an das Ende seiner Kraft gelangten Lebensentwurf, hier also: den europäischen.
Toleranz ist nämlich zunächst ganz und gar nichts Schwaches, sondern die lässige Geste eines Starken gegenüber einem Schwachen. Während ich hier sitze und vermessen den acht Todsünden von Konrad Lorenz eine neunte aufsattle, toleriere ich, daß eine meiner Töchter im Zimmer über mir trotz angeordneter Bettruhe vermutlich einen Tanz einstudiert. Von Toleranz diesen rhythmischen Erschütterungen gegenüber kann ich nur sprechen, weil ich a) einen klaren Begriff von angemessenem Verhalten in mir trage und die Störung als Abweichung von dieser Norm erkenne, b) in der Lage wäre, diese Abweichung nicht zu tolerieren, sondern sie zu beenden, c) sie tatsächlich im Verlauf meines Vater-Seins schon unzählige Male nicht toleriert habe.
Zur Verdeutlichung hilft es, mit allen drei Kriterien ein wenig zu spielen: Wer a) nicht hat, also Angemessenheit und Norm nicht kennt, muß nicht tolerant sein: Er wird jede Entwicklung hinnehmen und sich einpassen oder verschwinden, wenn es gar nicht mehr geht; wer b) nicht kann, der empfundenen Störung und Beeinträchtigung also hilflos gegenübersteht, kann keine Toleranz mehr üben: Er kann bitten und betteln und sich die Haare raufen oder über das Argument und die Mitleidsschiene den anderen zur Rücksichtnahme bewegen. Das Kräfteverhältnis hat sich jedoch verschoben, und wenn der Störer keine Rücksicht nehmen will, bleibt dem Schwächeren nur übrig, sich mit seiner Unterlegenheit abzufinden. Und c)? Toleranz kann kein Dauerzustand sein. Wer den Regelverstoß dauerhaft toleriert, setzt eine neue Regel, weitet die Grenze des Möglichen aus, akzeptiert eine Verschiebung der Norm. Zur Toleranz gehört der Beweis der Intoleranz wie zur Definition des Guten das Böse.
Toleranz ist also eine Haltung der Stärke, niemals eine, die aus einer Position der Schwäche heraus eingenommen werden kann. Wer schwach ist, kann nicht tolerant sein; wer den Mut zur eigentlich notwendigen Gegenwehr nicht aufbringt, kann seine Haltung nicht als Toleranz beschreiben, sondern muß von Feigheit, Rückzug und Niederlage sprechen: Er gibt Terrain auf – geistiges, geographisches, institutionelles Terrain. – (Quelle: Götz Kubitschek: Toleranz – Die 9. Todsünde der zivilisierten Menschheit, Sezession 28 / Februar 2009 [= Themenheft zu Konrad Lorenz], S. 26 f.)